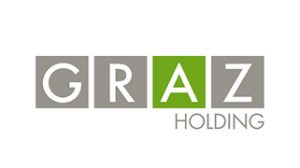Ökologische Fernwärme für Graz: das Energiewerk Graz
Das Energiewerk Graz (EWG) ist ein unverzichtbarer Baustein der Dekarbonisierungsstrategie. Es schafft Unabhängigkeit und Sicherheit durch lokale Kreislaufwirtschaft und Sektorenkopplung.

Das Projekt:
Die Fernwärmeversorgung im Großraum Graz hat sich in den letzten Jahren überaus positiv entwickelt und wesentlich zur Verbesserung der Luftqualität im Grazer Becken beigetragen. Stadt Graz, Land Steiermark, Holding Graz, Energie Graz sowie Energie Steiermark bündeln seit Jahren ihre Kräfte, um die Dekarbonisierungsstrategie voranzutreiben.
Trotz dieser Anstrengungen und Erfolge ist Erdgas aktuell ein wesentlicher Primärenergieträger für die Fernwärmeversorgung im Großraum Graz. Neben dem Umweltaspekt der CO2-Einsparung sowie der Versorgungs- und Entsorgungssicherheit ist insbesondere in Anbetracht der derzeitigen geopolitischen Situation die Realisierung alternativer Projekte zur schrittweisen Unabhängigkeit von Erdgasimporten ein Gebot der Stunde: Die Betriebszeiten der bestehenden Gaskesselanlagen am Standort Puchstraße können durch das Energiewerk Graz reduziert werden.
Einen bedeutenden Baustein in der Dekarbonisierungsstrategie stellen die Projekte „Energiewerk Graz“ und „Energetische Klärschlammverwertungsanlage in Gössendorf“ (EKV) dar.
In der ersten Phase wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, in der zweiten Phase geht es nun um die Vorbereitungen für die Umweltverträglichkeitsprüfung des Energiewerks Graz, die 2023 startete und bei der umwelt- und anrainerrelevante Aspekte geprüft werden. Auf Grundlage entsprechend positiver Prüfungsergebnisse erfolgt ein Baubeschluss und das Projekt kann von 2027 bis 2029 umgesetzt werden.
Als bestgeeigneter Standort für das Energiewerk Graz wurde in den durchgeführten Untersuchungen das Gelände des Fernheizkraftwerkes Graz (Puchstraße) identifiziert.
Folder Energiewerk Graz Stand Juli 2024)
-
Folder EWG Juli 2024
Grazer Fernwärmeversorgung benötigt EWG
Der Hauptaspekt des Projekts: Warum die Grazer Fernwärmeversorgung das EWG und die EKV benötigt
- Aktuell hohe Gasabhängigkeiten (Nachteile: Ökologie, Preisvolatilität, langfristige Versorgungssicherheit)
- Rund 60% der Grazer Haushalte werden mit Fernwärme versorgt – Tendenz: weiter steigend
- Förderfähigkeit des Fernwärmeausbaus ist von Ökologisierung und Effizienzsteigerung in der Fernwärmeerzeugung abhängig
- Ohne Errichtung des EWG ist erforderliche Ökologisierung/Effizienzsteigerung für Fernwärmeaufbringung im erforderlichen Ausmaß nicht machbar
- Insgesamt werden EWG und EKV knapp 20% der Fernwärme für Graz mit lokalen Reststoffen/Klärschlämmen erzeugen.
Das Energiewerk Graz (EWG) im Detail:
Das Energiewerk Graz trägt langfristig bedeutend zur Deckung des Verwertungs- und Energiebedarfs im Großraum Graz bei. Für die Fernwärmeerzeugung gibt es aktuell noch einen hohen Bedarf an Erdgas. Schon jetzt werden in der Abfallbehandlungsanlage der Holding Graz jährlich bis zu 110.000 Tonnen Reststoffe gesammelt.
Ab 2029 können die nicht wiederverwendbaren Reststoffe, welche nach Vermeidung, Sammlung, Wiederverwendung und stofflichem Recycling vor Ort übrig bleiben, energetisch genutzt werden. Für diese Stoffe ist die energetische Verwertung die bestmöglichste Nutzungsform, indem ökologisch nachhaltige Fernwärme und Strom für den Großraum Graz gewonnen werden.
Wir reduzieren damit bisher für die Fernwärmeerzeugung notwendige Gasimporte. Alle umwelt- und anrainer:innenrelevanten
Aspekte werden auch im Zuge einer transparenten Umweltverträglichkeitsprüfung umfassend gesichert.
Zahlen, Daten und Fakten zum Energiewerk Graz (EWG):
Nachhaltige Energieversorgung:
- Wir erzeugen 180 GWh ökologische Fernwärme pro Jahr, womit 23.000 Wohnungen versorgt werden können. Zusätzlich gewinnen wir 50 GWh Strom, womit wir 15.000 Wohnungen versorgen bzw. alternativ Wasserstoff erzeugen können. Damit reduzieren wir Erdgas in der Fernwärmeerzeugung und realisieren eine jährliche CO2-Einsparung von 15.000 Tonnen.
Sichere Verwertung:
- Nicht wiederverwendbare, ungefährliche Reststoffe werden dank lokaler Kreislaufwirtschaft vor Ort energetisch verwertet. Wir sichern damit für 40 Jahre die Entsorgungssicherheit für 450.000 Steirer:innen im Großraum Graz.
Stabile Preise und neue Arbeitsplätze:
- Wir werden unabhängiger von internationalen Energie- und Verwertungsmärkten. Das sorgt für Preisstabilität bei den Abfallgebühren und der Fernwärme. Zusätzlich schaffen wir regional 100 neue Arbeitsplätze.
Investition in die Zukunft:
- Wir investieren auf dem Industriegelände am Standort Puchstraße, direkt angrenzend an die Abfallbehandlungsanlage der Holding Graz, in eine nachhaltige Zukunft. Mit modernster Kraft-Wärme-Kopplung und Integration von hocheffizienten Wärmepumpensystemen produzieren wir ganzjährig Wärme und Strom. Die beste verfügbare Technik kommt zum Einsatz und sichert Effizienz und Umweltschutz.
Verkehrsentlastung:
- Durch die lokale energetische Nutzung der nicht recyclingfähigen Reststoffe werden jährlich 9.000 LKW-Fahrten eingespart. Dadurch reduzieren wir Emissionen, erhöhen die Verkehrssicherheit und steigern die Lebensqualität.
Fragen und Antworten
-
Das Projekt Energiewerk Graz (EWG) ist ein sehr wichtiges Zukunftsprojekt für Graz, da es langfristig bedeutend zur Deckung des Verwertungs- und Energiebedarfs der Stadt Graz beiträgt. Für Kommunen wird es immer wichtiger, Maßnahmen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, zum Klimaschutz und auch zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgungssicherheit im eigenen Einflussbereich umsetzen zu können. Diese Selbstversorgermodelle gewinnen immer mehr an Bedeutung, werden immer attraktiver und bringen der Bevölkerung wesentliche Vorteile und werden teilweise sogar von der Bevölkerung aktiv eingefordert. Zusätzlich wird durch eine lokale Reststoffverwertung die Unabhängigkeit von internationalen Energie- und Abfallmärkten gesteigert.
-
Der größte aktuelle Treiber des Projektes ist der Aspekt einer sicheren, sauberen und leistbaren Energieversorgung, insbesondere die zukünftige Strom- und Wärmeversorgung für den Großraum Graz. Die Fernwärmeaufbringung muss ökologischer und nachhaltiger werden, da der Anteil an Erdgas bei der Aufbringung der Fernwärme für den Großraum Graz aktuell noch zu hoch ist. Die Abhängigkeit von importiertem Erdgas soll reduziert werden, um bestehende und neue Kund:innen in Zukunft vermehrt mit Wärme aus ökologischen und nachhaltigen Quellen versorgen zu können.
Das Projekt Energiewerk Graz ist nicht nur ökologisch und ökonomisch sinnvoll, sondern auch ein entscheidender Schritt zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgungssicherheit.
-
Im Vorfeld zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurde eine fundierte Machbarkeitsstudie für das Projekt erstellt und 2022 der Öffentlichkeit präsentiert. Abgeleitet aus dieser Studie wurde empfohlen eine vertiefende Detailplanungsphase, in welcher auch die genehmigungsrelevanten Aspekte geprüft werden, weiter zu verfolgen.
Diese Planungs- und Detailkonzeptionierungsarbeiten sowie die Ausarbeitung der Umweltverträglichkeitserklärung für das Projekt EWG werden derzeit in der Energie Graz umgesetzt. Die Einreichung des Projekts bei der zuständigen Behörde wird bis 30.6.2024 erfolgen.
-
Die Machbarkeitsstudie beinhaltet auch eine Abschätzung der erforderlichen Investitionsmittel. Für das EWG werden rd. 250 Mio. EUR in die Infrastruktur investiert. Diese Investitionsmittel werden sich durch die daraus resultierenden Einsparungen gegenüber dem Status quo amortisieren.
-
Die Finanzierung der Errichtung und des Betriebs des EWG ist durch risikoreduzierendes Insourcing gesichert. Bisherige Zahlungen an Dritte (Erdgasimporte, Zukauf von Verwertungsdienstleistungen für Reststoffe) fallen weg, wodurch die Investition und der Betrieb finanziert werden. Es wird zu Einsparungen im Vergleich zum aktuellen Status kommen.
-
Bei Projektrealisierung wird hinsichtlich des Effektes auf die Beschäftigung mit der Schaffung von durchschnittlich rd. 100 Vollzeitarbeitsplätzen in der Steiermark gerechnet.
-
Bei positiver Absolvierung des Genehmigungsverfahrens (UVP-Verfahren) und einer folgenden positiven Baubeschlussfassung ist eine Inbetriebnahme des EWG im Jahr 2029 möglich.
-
Nach Auswahl der Expert:innen für die Durchführung der erforderlichen Planungs- und Detailkonzeptionierungsarbeiten wurde mit der Erstellung der notwendigen Unterlagen für die Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) begonnen. Bis spätestens 30.6.2024 soll das Projekt bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Zugleich wird ein proaktiver Bürger:innen-Dialog begonnen, in welchem auf Transparenz, umfassende Information und Kommunikation und damit auch auf die Inklusion von Vorbehalten und Gegenargumenten strikt Wert gelegt wird. Am Andreas-Hofer-Platz, im Kundenservicecenter der Energie Graz, ist ab Juni 2024 ein Projektinformationsstand für interessierte Bürger:innen eingerichtet.
-
Die Anlagengröße des EWG ist auf die Bedeckung des langfristigen lokalen Verwertungs- und Energiebedarfs ausgerichtet. Begründet durch diese bewusst lokalwirtschaftliche Ausrichtung ist die Anlage im internationalen Vergleich an der untersten Größengrenze bisher realisierter Anlagen dieser Art einzuordnen.
Entsprechend dieser Ausrichtung werden im EWG nur jene Reststoffe verwendet, welche nach Vermeidung, Sammlung, Wiederverwendung und stofflichem Recycling des Grazer Restmülls übrigbleiben. Für diese Reststoffe ist die energetische Verwertung die bestmöglichste Nutzungsform. Diese Reststoffe werden schon seit vielen Jahren direkt am Standort Sturzgasse der Holding Graz gesammelt. Zukünftig werden diese nicht via LKW von dort wegtransportiert zu teilweise weit entfernten Verwertungsanalagen, sondern über ein Förderband zum benachbarten Energiewerk Graz transportiert – dadurch können die Verkehrsentlastungen für Graz realisiert werden! Die Abfallbehandlungsanlage der Holding Graz in der Sturzgasse hat eine Jahreskapazität von bis zu 110.000 to.
-
In der Machbarkeitsstudie wurden in den Jahren 2020 bis 2022 mehrere Standorte geprüft. Die Eignung als Industriestandort, die Logistik der Reststoffe (Förderband) und die Einbindung in das Fernwärmesystem des Großraums Graz waren dabei wesentliche Kriterien. Zusätzlich wurde explizit berücksichtigt, welche Standorte ein Maximum an Verkehrsberuhigung im Vergleich zum Status quo sicherstellen. Für die Umsetzung des EWG hat sich der Standort Puchstraße, wo sich aktuell bereits das Fernheizkraftwerk befindet, etabliert. Dieser Standort befindet sich im Industriegebiet unmittelbar neben dem Grazer Ressourcenpark (ehem. „Sturzplatz“) und der Abfallbehandlungsanlage der Holding Graz, wo der Grazer Restmüll zentral gesammelt wird. Vergleichbar zu vielen anderen Städten kann so in unmittelbarer Nähe zur Sammlung auch die energetische Nutzung der Reststoffe erfolgen.
-
Das EWG besteht aus einem Kessel mit Rostfeuerung, einer Abgasreinigungsanlage auf modernstem Stand der Technik inkl. Rauchgaskondensation mit kombinierter Wärmepumpe sowie einem hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Verfahren zur Erzeugung von Wärme und Strom mit rd. 8.000 Betriebsstunden pro Jahr.
-
Mit dem EWG können in Summe rd. 180 GWh Fernwärme p.a. erzeugt werden. Dies entspricht, basierend auf einem aktuellen Wärmebedarf für den Großraum Graz, einer versorgungssicheren und frei von fossilen Energieträgern erzeugten Wärmemenge im Ausmaß von rd. 18 % des Gesamtbedarfs und deckt demnach den Bedarf von rd. 23.000 privaten Haushalten. Zusätzlich wird Strom für rd. 15.000 Wohnungen produziert und optional eine nachgelagerte Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse ermöglicht werden.
-
Im Energiewerk Graz wird durch die Kombination aus hocheffizienter KWK-Technologie mit nachgeschalteter Rauchgaskondensation und kombiniertem Wärmepumpensystem für eine möglichst hohe Gesamtenergieausbeute sichergestellt. Damit kann der Wärmeoutput der Anlage gesteigert und somit die Verbrennung von Erdgas zur Wärme- und Stromproduktion weiter reduziert werden.
Zur Effizienzoptimierung ist die Errichtung eines Wärmespeichers mit einem Nutzvolumen von 12.000 m³ vorgesehen, der auch für die Einbindung von zusätzlicher Abwärme und solarer Wärme in das Fernwärmesystem des Großraums Graz genutzt werden kann.
Durch den optionalen Betrieb einer am Standort integrierten Wasserstoff-Anlage kann zukünftig Wasserstoff für potenzielle Kunden als CO2-freier Treib- oder Brennstoff erzeugt werden. Die Verteilung des erzeugten Wasserstoffs wird dabei ausschließlich via Bahn erfolgen. Zusätzlich soll ein kleiner Teil des erzeugten Wasserstoffs zur Betankung und Dekarbonisierung innerbetrieblicher Nutzfahrzeuge (z.B. Müllsammelfahrzeuge) verwendet werden.Gesamthaft wird damit ein breites Produktportfolio (Strom, Wärme, Wasserstoff) zur Verfügung gestellt, womit ein Maximum an Dekarbonisierung und Ökologisierung realisiert wird.
-
Das historisch gewachsene Abfallwirtschaftssystem in Graz ist aktuell hinsichtlich der Verwertung von unvermeidbaren Reststoffen auf Kapazitätsangebote Dritter, sowohl im In- als auch im Ausland, angewiesen. Das heißt, dass die Abfälle in Graz gesammelt, sortiert und aufbereitet werden und dann über weite Strecken zu externen Verwertungsanlagen im In- und Ausland transportiert werden. Die Kapazitäten dieser Anlagen werden zugleich immer geringer, weshalb auch die Preise für die Verwertung und damit die Kosten für die Bürger:innen von Graz gestiegen sind. Aus diesem Grund ist das EWG zur langfristigen Sicherstellung der Entsorgungssicherheit, aber auch der Versorgungssicherheit und damit einhergehenden Preisstabilität für die Grazer:innen absolut notwendig und sinnvoll.
-
Nein. Das EWG basiert auf lokalwirtschaftlichen Prinzipien, um eine lokalwirtschaftliche Kreislaufwirtschaft sicherzustellen. Abfallimporte widersprechen diesem Prinzip. Es werden ausschließlich nicht recyclingfähige Reststoffe aus Graz und ergänzend aus dem steirischen Zentralraum eingesetzt werden.
-
Insbesondere die Ökologisierung und Dekarbonisierung der Strom- und Fernwärmeaufbringung, die steigende Unabhängigkeit von internationalen Energie- und Verwertungsmärkten, sowie die daraus resultierende Steigerung von Entsorgungs-, Versorgungs- und Preissicherheiten sind maßgebliche Effekte aus der mittels EWG erzielbaren Sektorenkopplungen „Abfallwirtschaft“ + „Energiewirtschaft“. Zusätzlich wird bei Projektumsetzung durch die Einsparung von rd. 1.000.000 bisher erforderlichen LKW-Transportkilometern p.a. ein wesentlicher Beitrag zur lokalen und überregionalen Verkehrsberuhigung geleistet. Wir sparen mit dem Energiewerk Graz 15.000 to CO2 p.a. ein, indem der Einsatz von bislang erforderlichen Gaskraftwerken entsprechend reduziert werden kann.
-
Durch die energetische Verwertung der Reststoffe wird Fernwärme für 23.000 Wohnungen in Graz bereitgestellt. Derzeit wird dafür auch importiertes Erdgas eingesetzt. Es werden ca. 15.000 Tonnen CO2 Emissionen aus der Erdgasverbrennung netto vermieden, da insgesamt mehr als 60.000 Tonnen CO2 Emissionen aus der Verbrennung von Erdgas vermieden werden, von welchen die CO2 Emissionen aus der energetischen Verwertung der Reststoffe in Abzug zu bringen sind. Anzumerken ist, dass die CO2 Emissionen aus der Verwertung der Reststoffe unvermeidbar sind, da diese auch jetzt schon wo anders energetisch verwertet werden bzw. bei Verrottung und Deponierung anfallen, jedoch ohne lokale Nutzung des in diesen Stoffen enthaltenen Energieinhaltes.
-
Sollte der Schwerpunkt nicht auf Vermeidung, Wiederverwendung und Recycling liegen?
Trotz der umfassenden Maßnahmen zur Abfallvermeidung, -wiederverwendung und -recycling ist und wird es nicht möglich sein, sämtliche anfallenden Abfälle im Kreislauf zu führen. Daher ist es jedenfalls erforderlich, für die bestmögliche Verwertung der Restabfälle (Reststoffe) die energetische Verwertung als nächste Stufe der Abfallhierarchie zu nutzen.
-
Die Arbeitsgruppe „Wärme 2030/2040“, bestehend aus Energie Steiermark, Holding Graz, Vertretern der Stadt Graz und der Energie Graz haben in den letzten 10 Jahren detaillierte Analysen angestellt, wie die Fernwärmeaufbringung für den Großraum Graz nachhaltig und versorgungssicher ausgerichtet werden kann. Das Projekt Energiewerk Graz ist für die Zielerreichung in der geplanten Zeitschiene und in Hinblick auf die Versorgungssicherheit sowie Leistbarkeit der Energieversorgung nicht durch andere Technologien ersetzbar und demnach für die angestrebte Dekarbonisierung der Grazer Fernwärme unerlässlich. Viele alternative Ansätze wurden geprüft, welche jedoch keine vergleichbare ökologische und wirtschaftliche Effizienz aufweisen, um das Projekt EWG sinnvoll ersetzen zu können.
Aus Sicht der Abfallwirtschaft und der auch in Zukunft notwendigen Verwertung von nicht recyclebaren Reststoffen ist das EWG in Graz eine deutliche Verbesserung, weil diese Reststoffe am Anfallsort aufbereitet und energetisch verwertet werden können, die Energie vor Ort genutzt werden kann und die Abfälle nicht über große Distanzen transportiert werden müssen.
-
Die Verbesserung der Luftqualität hat in Graz eine ganz besondere Bedeutung. Die möglichen Auswirkungen des EWG auf die lufthygienische Situation wurde daher bereits in der Machbarkeitsstudie für den vorgeschlagenen Standort von renommierten externen Expert:innen untersucht. Die Ausbreitungsrechnungen haben gezeigt, dass für den Standort Puchstraße die durch das EWG generierten Immissionen als irrelevant zu bezeichnen sind bzw. die Grenzwerte damit strikt eingehalten werden. Es kommt zu keiner Verschlechterung der Luftqualität. Diese Ergebnisse werden im Rahmen des UVP-Verfahrens durch Amtssachverständige des Landes Steiermark nochmals geprüft. Nur bei positiver Bestätigung dieser Ergebnisse wird das Energiewerk Graz in Betrieb gehen.
-
Nein. Es kommt sogar zu einer Verkehrsentlastung. Die Reststoffe aus der Stadt Graz müssen derzeit weite Wege bis zu den Verwertungsanlagen zurücklegen. Bei Projektumsetzung am Standort Puchstraße können die Verkehrsströme durch die Realisierung eines lokalwirtschaftlichen Kreislaufwirtschaftssystems sowie durch die Anbindung an die bestehende Schieneninfrastruktur sogar reduziert werden. Denn schon jetzt werden jedes Jahr bis zu 110.000 to. Reststoffe am Standort Sturzgasse gesammelt. Mit dem EWG können 1.000.000 LKW-km pro Jahr vermieden werden. Damit wird auch ein Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer geleistet, da Schwerverkehr reduziert wird.
-
Seitens der Energie Graz wird ein proaktiver Bürger:innen-Dialog geführt. Transparenz und Kommunikation werden unverändert der Maßstab und der Anspruch für die weitere Projektumsetzung sein. Fragen, Anregungen, aber auch kritische Stimmen, werden ernst genommen und sachlich gelöst und beantwortet. Hierzu stehen unterschiedliche Kommunikationsmittel zur Verfügung: persönlich, per Mail, Social-Media, Videokonferenz.
-
Das Energiewerk Graz wird mit der besten verfügbaren Technik errichtet. Mögliche beim Betrieb der Anlage entstehende Emissionen werden durch Primär- oder Sekundärmaßnahmen weitestgehend minimiert und führen daher zu keinen relevanten Belastungen für die Anrainer:innen. Es kommt sogar zu Entlastungen z.B. im Verkehrsaufkommen. Durch den Betrieb des EWG können die Betriebszeiten der sich am selben Standort befindlichen Wärmeerzeugungsanlagen im Fernheizkraftwerk Graz reduziert werden.
Schall- und Staubemissionen werden durch vollständige Einhausung sämtlicher Anlagenkomponenten vermieden. Technologisch bedingte Durchbrüche (z.B. Zu-/Abluftöffnungen) werden mit Schalldämpfern ausgerüstet.
Geruchsemissionen werden durch Absaugung der Luft aus dem Reststofflagerbereich und Nutzung als Verbrennungsluft vermieden.
Insbesondere im Rahmen der UVP für die Genehmigung des EWG werden sämtliche Aspekte objektiv und detailliert von der zuständigen Behörde geprüft und werden die Anrainer:innen entsprechende rechtliche Positionen im Verfahren erhalten. Ungeachtet der rechtlichen Rahmenbedingungen ist es unser Anspruch, die Fragen, Anregungen und Befürchtungen oder Ängste der Anrainer im Rahmen eines proaktiven Bürger:innen-Dialogs stets transparent und auf Augenhöhe frühzeitig und gemeinsam zu beantworten und zu lösen.
-
Die energetische Reststoffverwertung ist Stand der Technik in Österreich und in ganz Europa sowie darüber hinaus. Da noch immer große Anteile von Reststoffen in Europa deponiert werden, wird die energetische Reststoffverwertung weiter ausgebaut. In Österreich setzen vor allem Wien (4 Anlagen), Niederösterreich (1 Anlage) und Oberösterreich (2 Anlagen) auf eigene energetische Reststoffverwertung und die Einbindung der erzeugten Energie in die übergeordneten Strom- und Wärmeversorgungsnetze. Auch in Kärnten gibt es thermische Verwertungsanlagen für Reststoffe.
Dazu kommen weitere energetische Reststoffverwertungsanlagen im industriellen Umfeld, die ebenfalls Wärme in öffentliche Netze einspeisen, wie beispielsweise in Niklasdorf/Leoben, Bruck an der Mur und Arnoldstein.
-
Der Platzbedarf des EWG samt der erforderlichen Infrastruktur beträgt etwa 20.000 m² inkl. Verkehrs- und Grünflächen. Die ausgewählte Grundstücksfläche in der Puchstraße befindet sich im Industriegebiet, war schon bisher und wäre auch zukünftig für Naherholungszwecke der Grazer Bevölkerung nicht geeignet. Für die Nutzung dieser 20.000 m² Industrieflächen werden entsprechende Ausgleichsflächen am Gelände des Wasserschutzgebietes Weinzödl im Norden von Graz geschaffen, um auch für die Pflanzen- und Tierwelt durch die Projektrealisierung keine Einschränkungen oder Reduzierungen zu realisieren.
Kontakt und Infos (Energie Graz):
Kontaktieren Sie uns gerne unter:
0316 80 57 18 99
(Dienstag bis Donnerstag, 9 bis 15 Uhr)
Infos zum Infostand am Andreas-Hofer-Platz 15 (Voranmeldung notwendig) gibt es hier!